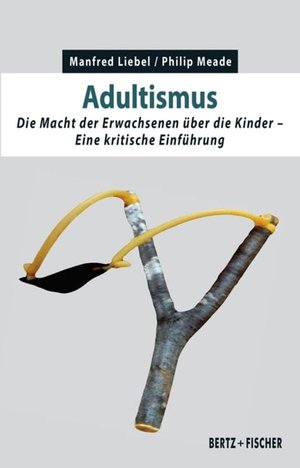Dass Erwachsene intelligenter und kompetenter sind als Kinder ist in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass wir Adultismus kaum hinterfragen. Welche Auswirkungen diese selbstverständliche Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen aber haben kann und mit welchen Maßnahmen wir dagegen steuern können.
Was ist Adultismus? Definition und Bedeutung des Begriffs
Unter Adultismus versteht man, wenn Menschen allein aufgrund ihres Alters diskriminiert werden. Erwachsenen (engl. "adults") wird dabei von vornherein ein größeres Wissen und mehr Kompetenz zugesprochen als Kindern oder Jugendlichen, sodass eine Machtungleichheit entsteht.
Beispiele für Adultismus
Wenn Meinungen z. B. von Schüler*innen nur deshalb nicht gehört werden, weil diese als "zu jung" gelten, ist diese Argumentation vorurteilsbehaftet und adultistisch. Das Gleiche gilt auch, wenn die Kindergartenleitung die Ideen von Kindern ignoriert. Doch auch besonders junge Eltern oder jüngere Teammitglieder werden aufgrund ihrer "mangelnden Erfahrung" oft nicht ernst genommen. Auch wenn politische Vertreter*innen das Wahlrecht ab 16 Jahren ablehnen, weil "die Jungen keine Ahnung haben", ist das Adultismus. Ein autoritärer Erziehungsstil legitimiert sich durch das Prinzip des Adultismus.
Adultismus in der Kita
Adultismus können wir überall finden, wo Erwachsene und Kinder aufeinandertreffen. Dazu gehören auch Krippen, Kitas und Kindergärten, in denen die Erzieher*innen allein die Entscheidungen darüber treffen, wann z. B. draußen gespielt wird, wann gegessen wird, wann Schlafenszeit ist usw.
Adultismus in der Schule
In der Schule kann uns Adultismus ebenfalls begegnen. Die Lehrkräfte bestimmen, wann welcher Stoff wie behandelt wird und werten über die Leistungen der Schüler*innen. Bei Verstößen gegen Regeln haben Lehrer*innen die Befugnis, Strafen zu verhängen. Umgekehrt gibt es diese Rechte nicht: Die Kinder und Jugendliche dürfen ihre Lehrkräfte nicht bewerten. Ein starkes Machtgefälle entsteht.
Auch unter Schüler*innen gibt es Adultismus, z. B. wenn ältere Schüler*innen jüngere demütigen oder abwertend als "Babys" bezeichnen. Der Adultismus, den die Älteren selbst erlebt haben, wird in diesem Fall direkt weitergegeben ("verinnerlichter Adultismus"), pflanzt sich also strukturell über die Generationen fort.
Ist Adultismus gleichbedeutend mit Gewalt?
Dass Erwachsene gegenüber Kindern als überlegen gelten, ist in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass Adultismus kaum hinterfragt wird. Das Prinzip gilt als selbstverständlich, sodass die Wenigsten es von vornherein als gewaltsam beschreiben würden. Wohl jeder von uns ist schon mit Adultismus in Berührung gekommen, zuerst als wir selbst noch Kinder waren, heute verhalten wir uns als Erwachsene bisweilen selbst adultistisch.
Adultistisches Verhalten kommt oft erstmal einigermaßen "harmlos" daher, z. B. wenn Eltern sich über Kinder spöttisch unterhalten, eine Erzieherin wegen der Ideen eines Kinds die Augen verdreht, es vor anderen belehrt oder in seinen Äußerungen unterbricht. Auch das Gegenteil – übertriebenes Lob oder Hervorstellen der Leistungen eines Kindes im Vergleich zu einem anderen – kann adultistisch sein, wenn es dazu dient, das Verhalten der Benachteiligten "von oben" in eine gewisse Richtung zu lenken.
Obwohl wir daran gewöhnt sind, kann Adultismus gefährlich sein: Denn Kinder lernen durch die Diskriminierung schon früh, dass es "normal" ist, andere abzuwerten und es Meinungen gibt, die allein deshalb mehr zählen, weil sie von einer bestimmten Personengruppe kommen. Auch verinnerlichen sie, dass Kinder "weniger wert" sind als Erwachsene und nehmen es hin, dass über sie bestimmt werden darf.
Durch das strukturelle Machtgefälle wird es für die benachteiligte Gruppe schwer, sich gegen ungerechte Behandlung zu wehren. Kinder sind z. B. rassistischen oder sexistischen Äußerungen von Lehrer*innen erstmal ausgeliefert und stehen extremem adultistischem Verhalten wie Drohungen, Anschreien oder Bestrafungen ohnmächtig gegenüber. So wird durch Adultismus der Weg zu körperlicher oder psychischer Gewalt gegen Benachteiligte geebnet und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Diskriminierung normalisiert.
Wie kann Adultismus vermieden werden?
Um Adultismus zu vermeiden, sollten wir
- mit Kindern auf Augenhöhe sprechen und eine gleichberechtigte Beziehung anstreben
- Kinder wertschätzen und in ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst nehmen
- uns unserer Privilegien als Erwachsene bewusst sein, sie kritisch hinterfragen und nicht zum Nachteil anderer nutzen, um Diskriminierung entgegenzuwirken
- Kindern und Jugendlichen – wo immer möglich – Mitbestimmungsrechte einräumen und ihre Meinung anhören
Adultismus und Partizipation
Wichtig ist es, zu verstehen, dass wir Adultismus nicht als "naturgegeben" hinnehmen müssen, sondern es die Aufgabe von Erwachsenen ist, ihre Rolle und ihr Verhalten gegenüber Jüngeren kritisch hinterfragen. Als ein wirksames Instrument gegen die negativen Folgen der Machtungleichheit zählt die "Partizipation" – die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsfindungen. Dazu geben Erwachsene einen Teil ihrer Macht ab, um mehr Gleichgewicht herzustellen.
Achtung! Partizipation ist kein "freiwilliges Entgegenkommen" von Erwachsenen, sondern in den Artikeln 12 und 13 der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben!
Konkrete Maßnahmen sind z. B.:
- Partizipation in der Kita: Kinder werden z. B. gefragt, welche Lebensmittel sie sich für das gemeinsame Frühstück wünschen, dürfen mit aussuchen, welche Bastelmaterialien angeschafft werden oder wie die Bauecke gestaltet werden sollen. Natürlich kann in der Praxis nicht alles mit den Kindern abgesprochen werden. Doch es ist wichtig, dass das pädagogische Personal sich der Machtungleichheit bewusst ist und sie nicht zum Nachteil der Kinder benutzt. In den letzten Jahren werden die Fachkräfte dahingehend intensiver geschult.
- SMV: Die Schülermitverwaltung ist an vielen Schulen im Organigramm verankert. Die Vertreter*innen dieses Gremiums werden von den Kindern und Jugendlichen ihrer Schule demokratisch gewählt. Die SMV wird in Sitzungen von der Schulleitung gehört und an Entscheidungsprozessen beteiligt.
- Evaluationsbögen: Sie kommen vor allem an Universitäten und Hochschulen zum Einsatz. Darin bewerten die (in diesem Fall schon älteren) Studierenden die Veranstaltungen von Dozenten und Professoren und die Auswertungen gehen an die Universitätsleitung.
- "Familienrat": Was auf der Ebene von Institutionen in puncto Partizipation funktioniert, geht natürlich auch schon im Kleinen. Kinder mitbestimmen zu lassen, was z. B. die Urlaubs-, Wochenend-, Tages- oder Mahlzeitenplanung angeht, zeigt ihnen, dass ihre Meinung wichtig ist und gehört wird. Auch etwaige Sanktionen für unangemessenes Verhalten können im Familienrat besprochen und auf Augenhöhe begründet werden. Dabei sind nach Möglichkeit alle Familienmitglieder anwesend.
Adultismus dient als Legitimation, Kinder einzuschränken, zu bestrafen und – zumindest früher – auch Gewalt gegen sie anzuwenden. In welchen Glaubenssätzen diese Diskriminierung mündet und wie wir ihnen begegnen können, erklärt Nora Imlau im Interview:
Was ist das Gegenteil von Adultismus?
Als Gegenteil von Adultismus kann Anti-Adultismus benannt werden. Es geht dabei aber nicht etwa darum, Kinder den Erwachsenen qua Gesetz gleichzustellen (Erziehungsberechtigte etc. haben darin immer noch ihre Berechtigung), eine Laissez-faire Erziehung zu propagieren oder etwa Kinder "an die Macht" kommen zu lassen. Das Ziel ist vielmehr, dass Erwachsene ihr Verhalten aktiv reflektieren, so mit der Machtungleichheit verantwortungsvoll umgehen und Kindern und Jugendlichen so viel Wertschätzung und Mitbestimmungsrechte wie möglich zugestehen.
Verhalten reflektieren
Auweia, wieder mal ertappt ... Viele von uns legen im Umgang mit unseren Kindern wohl öfter mal adultistisches Verhalten an den Tag. Ist ja auch gar nicht so einfach: Zum einen haben wir die Aufgabe, unsere Kinder zu beschützen, wir sagen also, was sie tun dürfen und was nicht. Dazu kommt, dass wir unseren Alltag managen müssen, der muss irgendwie funktionieren, sodass wir unseren Kids oft keine Wahl z. B. über den Tagesablauf lassen und "von oben herab" diktieren.
Unsere Aufgabe als Erwachsene sollte es dabei aber sein, unser Verhalten regelmäßig zu reflektieren und unsere Macht kritisch zu hinterfragen: Wie spreche ich gerade mit meinem Kind? Würde ich mit einem Erwachsenen auch so sprechen? Nehme ich die Ideen meines Kindes ernst? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich ständig fremdbestimmt würde? Dient diese Regel wirklich dem Schutz des Kindes oder ist sie eher dazu da, es mir bequemer zu machen? Wo kann ich mehr Möglichkeiten finden, dass mein Kind seine Sicht der Dinge einbringen und über unseren Alltag mitbestimmen kann?
Ein gutes Instrument dazu ist die Gewaltfreie Kommunikation. Sie kann uns helfen, noch mehr "Augenhöhe" und Demokratie in unsere Familien einziehen zu lassen.
Ihr möchtet euch tiefer gehend mit Adultismus beschäftigen? Dann können wir euch z. B. dieses Buch empfehlen:
Quellen: Deutsches Kinderhilfswerk, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Amadeu Antonio Stiftung, Universität Lübeck